


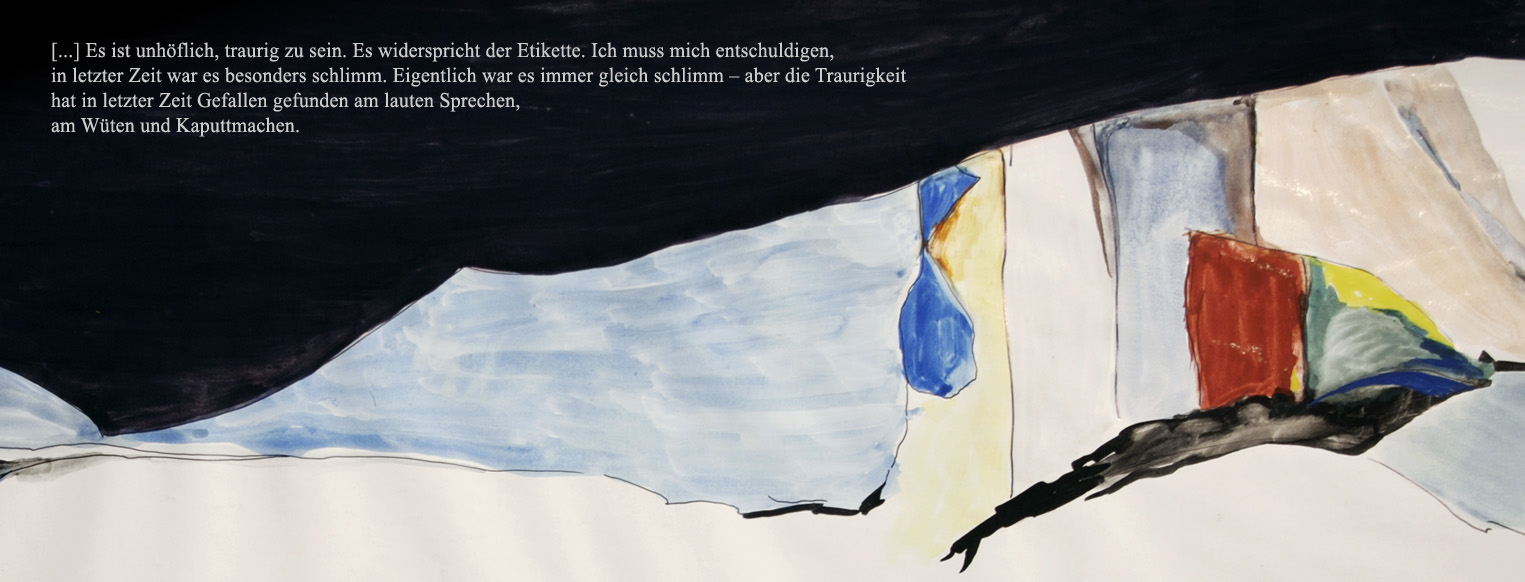

Boa, Attila
Zur Verteidigung der Traurigkeit
Essay
104 Seiten, 19x12cm Broschur, 13€
herausgegeben von Richard Pils
ISBN 978-3-99028-359-2
© Verlag Bibliothek der Provinz
www.bibliothekderprovinz.at
[...] Ist es nicht an der Zeit, wirklich außer Acht zu lassen, was ich
nicht mehr glauben kann? An der Zeit, jener Logik
einen Raum zu geben, die sich hinter meiner Traurigkeit verbirgt? Der
Versuch einer kleinen,
privaten, von der Hoffnung befreiten Anthropologie. Der Versuch zu einer
Expertise der Nüchternheit.
[…] Welche Leichtigkeit hat dagegen die Entscheidung, gegen eine
bestimmte Unterdrückung oder
Ungerechtigkeit, gegen irgendeinen Zustand – oder auch gegen beliebige
Windmühlen zu kämpfen.
Der Unterschied scheint akademisch, ist aber fundamental: Alle Bestrebungen,
die aus dem Bewusstsein des Guten heraus
begründet wurden, sind zu Katastrophen ausgeartet. Erst im Namen
des Guten wird der Mensch wirklich bestialisch.
Alexander Sury, "Der
Bund" 25.8.2015
Nicht geboren werden ist das Beste
Radikal: Der Berner Attila Boa holt aus zur «Verteidigung der Traurigkeit».
Im Dezember 2013 brach er zusammen mit dem Regisseur Michael Glawogger
und einem Tonmann auf zu einem «Doku-Experiment» ohne vorgefertigtes
Konzept. Der in Bern geborene Kameramann Attila Boa («More than
honey») filmte auf dem Balkan, in der Sahara und in Westafrika.
In Liberia endete die für die Dauer von rund einem Jahr geplante
Reise indes abrupt, Regisseur Glawogger starb überraschend an den
Folgen einer Malaria-Erkrankung. Ein Schock für die Crew-Mitglieder,
der zweifellos auch eine grosse Traurigkeit auslöste, Trauer über
den plötzlichen Verlust eines Weggefährten.
Der 49-jährige Boa zielt allerdings in seiner ersten Buchpublikation
nicht auf diese an einen konkreten Auslöser gebundene Traurigkeit
ab – sein Essay «Zur Verteidigung der Traurigkeit» versucht
vielmehr einen Seinszustand mit grösstmöglicher Präzision
zu durchleuchten. Es herrscht ein nüchterner, analytischer, zuweilen
auch ein dem Gegenstand angemessener trauriger Tonfall. Als unhöflich
gelte es in unserer Gesellschaft, traurig zu sein, weiss Boa, den es verstosse
gegen die «Etikette». Der Kameramann stellt als Autor die
Blende seines Schreibobjektivs so ein, dass kaum mehr Licht durch den
Strahlengang gelangt – entsprechend düster ist dieses Menschenbild,
mitunter fast nachtschwarz. «Natürlich bin ich traurig, muss
das noch gesagt sein?», heisst es auf den ersten Seiten. Fremd und
isoliert fühlt sich dieser Mensch in der Welt, fremd sind ihm seine
Gedanken und Gefühle, keine Ideen entfalten eine rettende Kraft,
die im Moment Nähe schaffende Liebe zwischen zwei Menschen ist nur
«beginnende Entfernung». Selbstmord wird als unbefriedigende
Option verworfen, weil über die Tötung des eigenen Körpers
hinaus keine Gewissheit besteht, dass dann wirklich «alles vorbei»
ist.
Man folgt Boas stilistisch eleganter Beweisführung nicht zuletzt
darum gespannt, weil er seine Gedanken immer wieder aphoristisch zuzuspitzen
weiss. So notiert er im Zusammenhang mit der Erörterung des Selbstmords:
«Wären wir zur Tätlichkeit an unserer Seele fähig,
wir würden uns routinemässig ihrer entledigen.» Der gewaltige
Einfluss des rumänischen Philosophen und Aphoristikers Cioran und
seiner radikalen Kulturkritik ist nicht zu überlesen. Auf seiner
Homepage zitiert Boa ihn prominent: «Das Licht ist eine Halluzination
der Nacht.» So hoffnungslos sich die Lage präsentiert, die
Tugend der Traurigkeit ist dennoch nicht zu unterschätzen. Nicht
nur ist der traurige Mensch besonders hellhörig für falsche
Empfindungen, er ist auch immun gegen religiöse und andere Wahnideen
und deshalb unverzichtbar für das Überleben der menschlichen
Gattung. Und es zeigt sich ein Silberstreifen am Horizont, ein fast buddhistisch
zu nennender Trost: Das Überwinden «jahrzehntelanger Selbstquälerei
durch die Anerkennung der eigenen Nichtigkeit». Boa hat diesen «weissen
Fleck» schon als Kind gemalt.
Isabella Kresse, Filmbar 2013
"Du schreibst wie ein siebzigjähriger Hassprediger"
